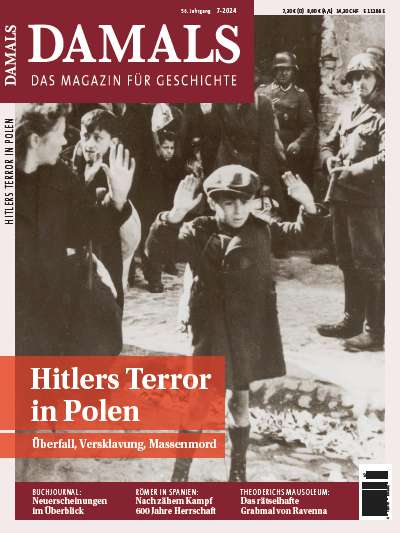In der Spätantike gab es auch in Mitteleuropa schon frühe Christen. Davon zeugt auch ein Reliquienschrein, den Archäologen in einer ehemaligen römischen Siedlung in Österreich entdeckt haben. Der im Altar einer Kirche verborgene Schrein enthielt die Bruchstücke einer Pyxis aus Elfenbein, die mit Schnitzereien von biblischen Szenen verziert war. Dieses rund 1.500 Jahre alte Gefäß enthielt vermutlich einst die Knochen einer Heiligen oder eines Heiligen und wurde als heiliges Relikt begraben. Unklar ist bislang noch, wie die Römer zu diesen Gegenständen kamen.
Bereits seit 2016 erforschen Archäologen die Überreste einer großen römischen Siedlung in der Gemeinde Irschen in Kärnten. Neben persönlichen Gegenständen der früheren Bewohner fanden sie bei ihren Grabungen bereits mehrere Wohnhäuser, eine Zisterne und zwei christliche Kirchen. In einer dieser Kirchen hat das Team um Gerald Grabherr von der Universität Innsbruck im August 2022 einen spätantiken Reliquienschrein aus Marmor entdeckt. Die etwa 20 mal 30 Zentimeter große Kiste war unter dem Altar einer Seitenkapelle verborgen.

In dem Schrein befanden sich unter anderem die Fragmente einer sogenannten Pyxis. Diese „Dose“ war aus Elfenbein gefertigt und reich mit Schnitzereien verziert. In solchen Büchsen bewahrten Kleriker damals sakrale Objekte wie Weihrauch, Reliquien oder Hostien auf, wie Grabherr und seine Kollegen berichten. In Schreinen deponierte Reliquien, wie beispielsweise die Knochen eines Heiligen, wurden allerdings für gewöhnlich mitgenommen, wenn eine Kirche aufgegeben wurde. Die nun in dem Marmorschrein entdeckte Elfenbein-Pyxis haben die römischen Christen bei ihrem Abzug hingegen offenbar zurückgelassen. Bei dem Gefäß handelt sich daher um eine seltene und spektakuläre Entdeckung. „Weltweit wissen wir von circa 40 derartigen Elfenbeindosen“, erläutert Grabherr.
Aufwendige Untersuchung des Reliquiars aus Elfenbein
Nun haben Grabherr und seine Kollegen die einzelnen Stücke der Elfenbeinpyxis genauer untersucht. Dafür mussten sie die zerbrechliche Büchse allerdings zunächst aufwendig konservieren, indem sie sie langsam und behutsam trockneten. „Elfenbein nimmt die Feuchtigkeit der Umgebung auf und ist in diesem Zustand sehr weich und leicht zu beschädigen“, erklärt Ulrike Töchterle, die die Restaurierungswerkstatt in Innsbruck leitet. „Unkontrolliertes Austrocknen führt wiederum schlimmstenfalls zu Schrumpfungen und Rissen und damit zu Schäden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.“ Trotz des monatelangen Trockenprozesses konnten die Archäologen die Pyxis allerdings nicht mehr in ihren Originalzustand zurückversetzen, weil die größeren Teile bereits verformt waren. Das Team arbeitet aber bereits an einer vollständigen 3D-Rekonstruktion.
Dennoch gaben die Scherben einige Geheimnisse preis: Die Anordnung der Dosenfragmente im Schrein deutet nach Ansicht der Forschenden darauf hin, dass die Elfenbeinpyxis bereits in der Spätantike – vor rund 1.500 Jahren – zu Bruch gegangen ist und im Altar der Kirche bestattet wurde. Die Archäologen gehen davon aus, dass die Dose davor die Reliquien einer heiligen Person enthielt. „Die Pyxis wurde vermutlich ebenfalls als heilig gesehen und wurde auch so behandelt, sozusagen als Berührungsreliquie“, sagt Grabherr. Auch wenn es sich bei der Dose nicht um eine klassische Reliquie wie einen Knochen einer Heiligen oder eines Heiligen handelt, sei sie dennoch wichtig – damals wie heute. „Die archäologische und kunsthistorische Bedeutung der Pyxis ist nicht zu bestreiten“, betont Grabherr.

Schnitzereien zeigen biblische Szenen
Das Äußere der Pyxis war mit verschiedenen christlichen Motiven verziert, wie die Analysen außerdem ergaben. Die Bilder zeigen beispielsweise einen Mann am Fuß eines Berges, über dem eine Hand aus dem Himmel ragt, die etwas zwischen die Arme dieser Person legt. „Das ist die typische Darstellung der Übergabe der Gesetze an Moses am Berg Sinai“, sagt Grabherr. Auch andere biblische Gestalten sind auf der Dose verewigt, darunter ein Mann auf einem Wagen, vor den zwei Pferde gespannt sind. Eine aus den Wolken ragende Hand zieht diese Figur in den Himmel. „Wir vermuten hier eine Darstellung der Himmelfahrt Christi“, so der Archäologe. Damit verbinden die Schnitzereien auf der Pyxis Szenen aus dem Alten Testament mit Szenen aus dem Neuen Testament. Das ist typisch für die Spätantike, sagt Grabherr. „Vor allem die Darstellung der Himmelfahrt Christi mit einer sogenannten Biga, einem Zweigespann, ist aber sehr besonders und bisher nicht bekannt.“
Unklar ist bislang noch, woher die Römer die Materialien für den Schrein und seinen Inhalt hatten. „Zum einen ist noch eine exakte Herkunftsbestimmung des Marmors ausständig. Mittels Isotopen-Untersuchungen wollen wir auch die Herkunft des Elfenbeins beziehungsweise des Elefanten bestimmen“, erklärt Töchterle. Auch die metallischen Scharniere am Deckel der Pyxis und der Kleber, mit dem diese am Elfenbein befestigt wurden, werden noch näher untersucht. Darüber hinaus fanden die Archäologen in der Marmorkiste Holzteile, die vermutlich zum Verschluss der Pyxis gehörten. „Auch diese Holzteile werden noch näher bestimmt. Uns interessiert hier vor allem die Holzart und seine Herkunft, aber auch das Alter ist dabei spannend“, sagt Töchterle. Diese Details könnten weitere Einblicke in die Lebensweise und die religiösen Praktiken der Römer liefern.
Quelle: Universität Innsbruck